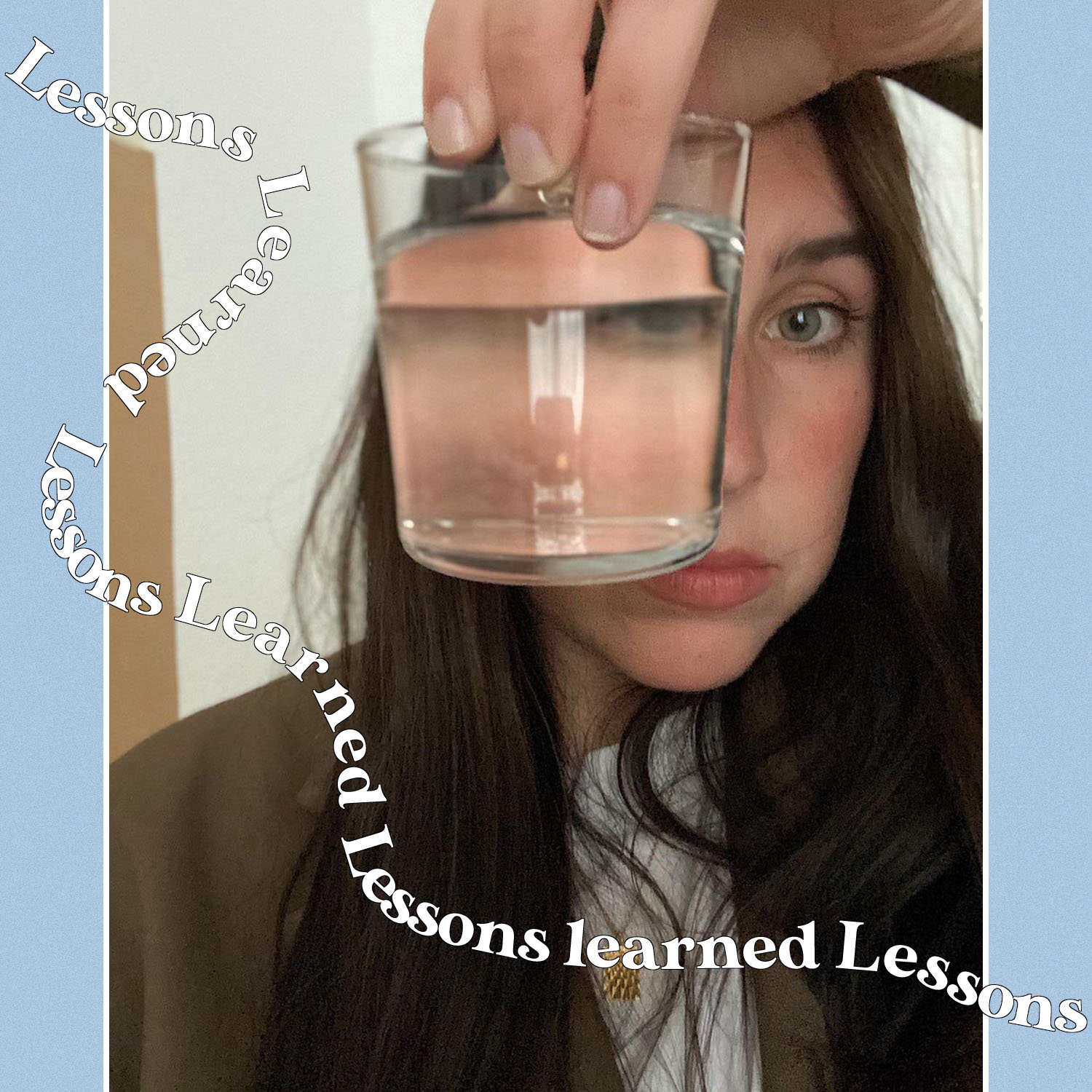Dass ich Therapien sehr wertschätze, ja sogar glaube, dass sie uns allen guttun würden, erwähnte ich bereits an der ein oder anderen Stelle. Und weil ich in meinen vergangenen Sitzungen jede Menge gelernt habe, habe ich heute die sieben wichtigsten Learnings, von denen ich glaube, dass sie auch euch (ganz gleich, ob ihr mit einer psychischen Erkrankung lebt oder nicht) helfen können, noch einmal ausführlich niedergeschrieben:
1. Hinterfrage deine Ängste
„Und was wäre das Schlimmste, das eintreffen könnte?“, höre ich die Worte meiner früheren Therapeutin stets in meinem Kopf nachhallen, wenn sich meine Ängste und Zweifel mal wieder verselbstständigen. Tatsächlich hilft mir diese Fragestellung noch heute dabei zu ergründen, ob der „Worst Case“ wirklich so schrecklich wäre, wie ich ihn mir in Gedanken ausmale. Dort nämlich blase ich ihn meist so riesig wie einen Heißluftballon, der kurz vor dem Platzen steht, auf und traue mich kaum mehr hinzuschauen, obwohl die Realität oftmals weniger schlimm aussieht — selbst dann, wenn sie nicht so verläuft, wie ich es mir erhoffe. Das rationale Nachfragen hilft übrigens auch dabei, Lösungsansätze sowie einen Umgang mit Niederlagen oder Situationen, die mir im Vorhinein Angst machen, zu finden, und das verleiht wiederum ein Gefühl von Sicherheit.
2. Eine Liebeserklärung an dich selbst
Den ersten Brief an mich selbst schrieb ich während der Reflexionstage in der zehnten Klasse. Unsere Betreuer*innen schickten sie einige Wochen später an uns ab und während ich die Zeilen so las, habe ich ziemlich angefangen zu weinen. Jene Aktion wiederholte ich auf Aufforderung meiner Therapeutin zum Abschluss meiner ersten Therapie und irgendwann, als ich den Tag schon längst vergessen hatte, trudelte der Umschlag in meinem Briefkasten ein. So ein Liebesbrief an einen selbst ist nicht bloß ein ziemlich guter Reminder an all die Dinge, die man sich sonst nicht selbst zugesteht, sondern auf eine merkwürdige Art und Weise auch ganz schön befreiend. Der Clou: Schreibt den Brief so, als würdet ihr ihn an eure engste Freundin richten, dann fühlt es sich auch gar nicht mehr blöd an. Hebt die Zeilen anschließend in eurer Notfall-Kiste (dazu in Punkt 5 mehr) auf, damit ihr sie hervorholen könnt, wann immer ihr es braucht.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
3. Nicht alles ist ausschließlich negativ — auch nicht die eigene psychische Krankheit
Keine Frage, eine psychische Erkrankung ist nicht gerade das schönste Ereignis im Leben und doch erklärte mir ein Therapeut einmal, es gäbe doch meist auch positive Aspekte. In meinem Fall sei das etwa die gute Menschenkenntnis und die Fähigkeit, andere Personen einzuschätzen und mich in sie hineinversetzen zu können. Und auch Ängste können zuweilen aufmerksamere, gar achtsamere Menschen aus uns machen. Mindestens aber setzen wir uns oftmals verstärkt mit uns selbst auseinander und wissen so (mit genügend Zeit) auch was uns guttut und was uns eher schadet.
4. Kenne deine Trigger
Die eigenen Trigger zu kennen, kann oftmals davor bewahren, überhaupt erst in einen negativen Gedankenstrudel zu geraten. Denn ganz gleich, ob man mit einer psychischen Erkrankung lebt oder sich als gänzlich gesund wahrnimmt, lösen bestimmte Dinge in jeder*m von uns etwa Nervosität, Ärger, Stress oder Trauer aus. Zuweilen kann es also auch schon ausreichen, zu wissen, dass die eigene Unruhe etwa am permanenten Konsum negativer Nachrichten liegt. Ein aktuelles Beispiel: Die ständige Auseinandersetzung mit den steigenden Zahlen der Covid-19-Infizierten sorgte in meinem Freundes- und Bekanntenkreis für Stress, der sich nicht nur einmal in Schlaflosigkeit und Herzrasen äußerte. Wer weiß, welche Themen, Bilder oder Worte zu den eigenen Triggern zählen, kann diese offen kommunizieren und sie so in Gesprächen vermeiden oder die Häufigkeit der Auseinandersetzung reduzieren und eingrenzen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
5. Packe eine Notfall-Kiste
Notfall-Kisten sind ziemlich großartig. Ja, ich würde sogar soweit gehen, sie als eine der besten Erfindungen überhaupt zu betiteln. Mein erstes, ganz eigenes Exemplar packte ich vor etwa zehn Jahren so voll, dass sich der Deckel kaum noch schließen ließ, bloß weil ich sichergehen wollte, dass auch wirklich alles darin verstaut war. Was genau in eine solche Notfall-Kiste kommt, bleibt jeder*m selbst überlassen, solange es sich denn um Dinge handelt, die wirklich glücklich machen, ablenken oder zumindest ein gutes Gefühl auslösen. Das können etwa Listen mit Serien, Filmen, Dokus, Playlisten, Podcast-Folgen und Büchern, aber auch Fotos, (positive) Erinnerungen, Nagellack, Badesalz und Skizzenbücher — eben alles, auf das man in Notfällen zurückgreifen kann, sein. Denn ist man erst einmal in einem Negativstrudel angelangt, so viel weiß ich mittlerweile, fehlt oftmals die Kraft, sich auf die Suche nach positiven Dingen zu machen. Gerade das macht eine vollgepackte Kiste so wichtig.
6. Höre auf, andere Menschen zu idealisieren
Früher, da neigte ich oftmals dazu, Menschen in meinem Leben zu idealisieren, was nicht nur einmal in einer toxischen Freundschaft endete. Das Problem: Beginnt man erst einmal, Personen zu idealisieren, setzt man deren Bedürfnisse, Wünsche und Gefühle oftmals über die eigenen, bis man sich irgendwann selbst ein wenig verliert. Zu realisieren, dass es gar nicht möglich ist, stets den anderen Ansprüchen zu genügen (zumindest nicht ohne sich bis zur Unkenntlichkeit zu verbiegen), man also nie den Status der „vollkommenen Perfektion“ erreicht, war für mich gleichermaßen beängstigend als auch befreiend, denn zum ersten Mal verstand auch ich: Die einzigen Ansprüche, denen ich genügen muss, sind meine eigenen.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
7. Deine eigenen Grenzen sind wichtig. Die der anderen aber auch.
Zu verstehen, dass mein Partner nicht mein Therapeut ist, brauchte eine Weile, war dafür aber umso wichtiger — nicht nur für mich, sondern auch für ihn, denn die Last und Verantwortung, die wir ihm gemeinsam auferlegten, war eigentlich nicht die seine. Natürlich hört man in einer jeden Beziehung, Freundschaft und Partnerschaft zu, versucht zu verstehen, zu unterstützen und zu helfen, aber eben nur bis zu einem bestimmten Punkt. Wo genau die eigenen Grenzen liegen, sollte deshalb gut ergründet, festgelegt und vor allem kommuniziert werden, damit jene Personen, die einem wichtig sind, nicht in Rollen, die eigentlich gelernten Therapeut*innen unterliegen, abgedrängt werden. Und auch wenn es zunächst für beide Seiten schwierig, vielleicht sogar schmerzhaft sein kann, ändern Grenzen natürlich nichts an Gefühlen oder der Wichtigkeit von Beziehungen − im Zweifel nämlich lösen sie genau das Gegenteil aus.