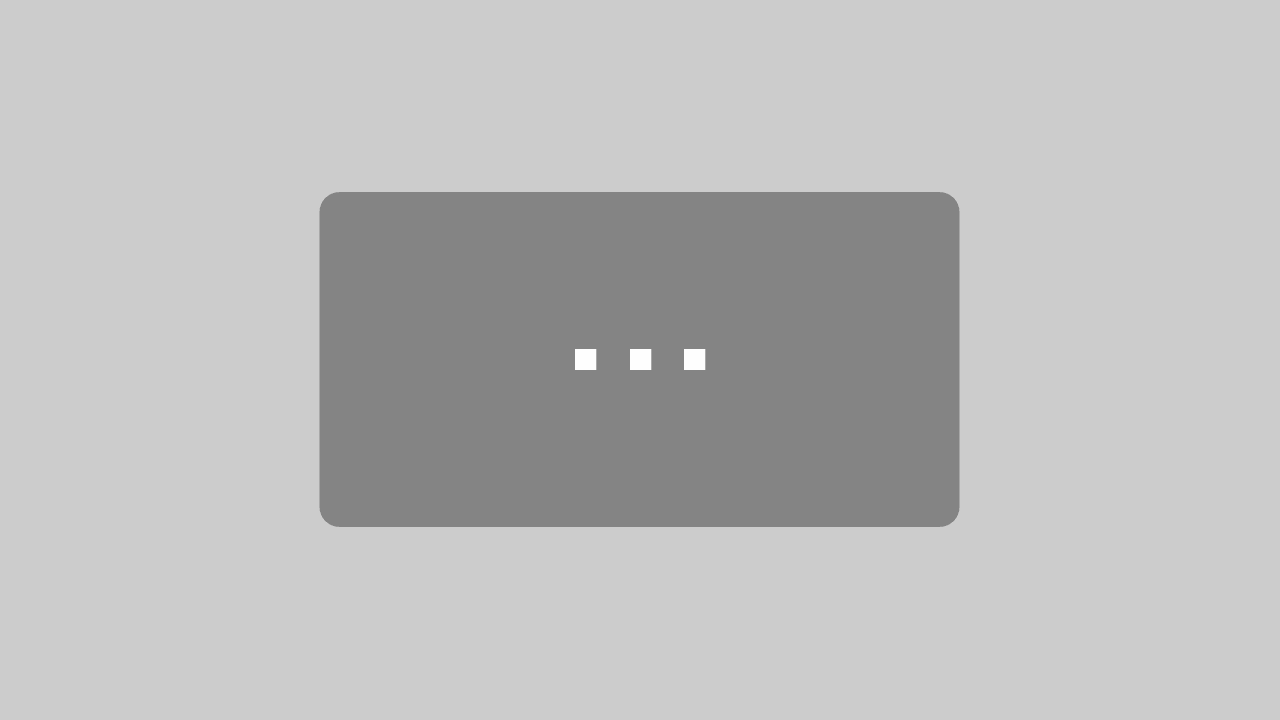Huch, wo ist nur der Juli geblieben? Die Wochen fliegen so dahin und letztens, bei der Zahnärztin, wusste ich nicht einmal, welcher Wochentag war. Aber noch ist Juli und damit Zeit, vier Dinge (im weitesten Sinne) vorzustellen, die mir in letzter Zeit Freude bereitet, mich interessiert, inspiriert und unterhalten haben. Und mich vielleicht auch im August begleiten werden.
Oliwia Hälterlein & Aisha Franz: Das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Ein breitbeiniges Heft (MaroVerlag)
Früher, da waren meine Freundinnen und ich sehr besorgt um unser Jungfernhäutchen. Die eine hatte gelesen, es könne beim Fahrradfahren reißen, die andere hatte Angst, dass es dank des Häutchens beim ersten Geschlechtsverkehr furchtbar wehtun würde. Beim Klassenausflug zu Pro Familia wurde uns Mädchen dann ein skandinavischer Aufklärungsfilm vorgeführt, in dem empfohlen wurde, das Jungfernhäutchen doch am besten selbst zu zerstören, damit man unbeschwert Sex haben könne (Kommentar der Pro Familia-Beraterin: „Diesen Tipp bitte nicht befolgen!“). Heute bin ich ein paar Jahre älter und hoffentlich auch schlauer. Ich weiß mittlerweile: Das Jungfernhäutchen ist ein Mythos, aber ein ganz schön hartnäckiger. Glücklicherweise haben die Kulturwissenschaftlerin Oliwia Hälterlein und die Illustratorin Aisha Franz beschlossen, mit all den Mythen und Vorurteilen rund um das Jungfernhäutchen aufzuräumen – und zwar gründlich.
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Das Ergebnis ist ein circa 50 Seiten starkes „breitbeiniges“ Heft namens Das Jungfernhäutchen gibt es nicht. Informativ, leicht verständlich und aus einer feministischen Perspektive schreibt Hälterlein darüber, woher der „Mythos Jungfernhäutchen“ eigentlich kommt und warum er so schädlich für Mädchen und Frauen ist. Kulturell-gesellschaftliche Analysen wechseln sich dabei ab mit persönlicheren Reflexionen, immer begleitet von Franz‘ knallig-bunten Illustrationen. Text und Gestaltung gehen dabei eine perfekte Symbiose ein, das Ganze fühlt sich angenehm zine-ig und hochwertig an. Ein wichtiges Thema ist für Hälterlein die Sprache, beziehungsweise das Fehlen von Sprache: „Wie ist es möglich, den Mythos ‚Jungfernhäutchen‘ zu de-konstruieren, ohne ihn mit der gewohnten Wortwahl zu re-produzieren?
Das Sprechen über die Inhalte des Patriarchats, auch wenn es um Kritik am diskriminierenden Zwei-Geschlechter-System und an sexistischen Mythen geht, bleibt ein Sprechen in der Sprache des Patriarchats, mit seinem Wortschatz und seiner Ideologie.“ Wie also über das sogenannte Jungfernhäutchen sprechen? Hälterlein und Franz lösen das Problem, indem sie im Heft den Begriff „Jungfernhäutchen“ im Text durch verschiedene Illustrationen ersetzen (und so außerdem zeigen, dass dieses Stück Haut ganz unterschiedlich aussehen kann).
Ich habe, obwohl ich von mir behaupten würde, in Sachen Jungfernhäutchen ganz gut informiert zu sein, aus Das Jungfernhäutchen gibt es nicht noch eine Menge gelernt. Habe plötzlich Zusammenhänge gesehen, die mir vorher so nicht bewusst waren – und möchte Oliwia Hälterleins Schlussappell in Neonfarben an diverse Wände sprühen: „An alle Medziner*innen: Schreibt die Bücher um! An alle Könige des Südens, Ostens, Westens und Nordens: Runter vom Thron! An alle Lehrer*innen: Benennt die Körperteile anatomisch richtig! An die Pornoindustrie: Schmeißt das Kunstblut in den Müll! An alle Eltern und Freund*innen: Schleimhaut-Talk!“
Das Jungfernhäutchen gibt es nicht (MaroVerlag)
HAIM: Women in Music Part III
Wenn Dua Lipas Future Nostalgia mein Album des Frühlings war (ernsthaft: fast jeder Song ein Hit!), dann ist das neue Album der HAIM-Schwestern definitiv mein Sommer-Album. Schwebende Klänge und jaulende Gitarren prägen Women in Music Part III, was sich erstmal nicht so anhört, als wären das Dinge, die gut zusammenpassen – tun sie aber. Die Grundstimmung des Albums ist lässig-zurückgelehnt und viele der Songs sind herrlich unaufgeregt und dennoch raffiniert. Beim Hören wähnt man sich im sonnigen Kalifornien, aber eher im Kalifornien von gestern als in dem von heute. Ein Kalifornien, in dem es nicht überraschend wäre, an der nächsten Ecke Joan Didion mit ihrer gigantischen schwarzen Sonnenbrille zu begegnen. Women in Music Part III ist an vielen Stellen entschieden retro, aber nie nostalgisch. Es geht um klassische – und daher moderne – Themen wie Trauer, Sexismus und Beziehungen. Das klingt manchmal wehmütig, manchmal euphorisch, und immer wunderbar leicht, selbst wenn Danielle Haim darüber singt, dass Männer im Musikbusiness sie und ihre Schwestern nicht ernst nehmen (Man from the magazine). Ich habe Women in Music Part III auf dem Rasen im Park liegend gehört, beim Kochen und sogar beim Putzen und kann bestätigen, dass das Album zu jeder dieser Situationen perfekt passt. Übrigens sind die zu den Songs gehörenden Videos ebenfalls kleine Meisterwerke: In ihnen laufen die HAIM-Schwestern oft beschwingt durch Los Angeles oder tanzen minimalistische Choreografien.
HAIM: I know alone (Video)
HAIM: The steps (Video)
HAIM: Summer Girl (Video)
Fran Lebowitz is never leaving New York (New Yorker)
Dieses Interview mit der amerikanischen Schriftstellerin Fran Lebowitz geht mir nicht mehr aus dem Kopf, seit ich es Anfang April auf der Seite des New Yorker las. Vorher war ich mir der Existenz Lebowitz‘ vage bewusst, hatte mich aber nie wirklich mit ihr beschäftigt. Seit ich das Interview gelesen habe, bin ich besessen von ihr. Da wäre zunächst Lebowitz‘ Stil: Die Frau ist 69 Jahre alt und trägt seit Jahren ganz selbstverständlich und ungerührt das immer gleiche Outfit aus Sakko, Hemd und Jeans. Dazu eine Zigarette und eine auffällige Brille – und voilà: Schon habe ich Fantasien, in denen ich ebenfalls eine solche Uniform trage und mir außerdem das wichtigste Accessoire besorgt habe, nämlich den unbeeindruckten Blick. Ein Blick, der sagt: Mir doch egal, was andere denken. Fran Lebowitz‘ Outfits sind also ein Traum. Noch besser aber ist das bereits erwähnte Interview. Darin plaudert Lebowitz (plaudert jemand wie sie überhaupt?) über Corona, Selbstisolation und die Kunst des Nichtstuns. Das Interview selbst bietet zu viele Highlights, als dass ich sie hier angemessen zusammenfassen könnte, aber besonders gut gefallen hat mir diese Stelle: Lebowitz, die mit Handies und Co auf Kriegsfuß steht, wird danach gefragt, ob die Tatsache, dank Covid-19 die ganze Zeit alleine in der Wohnung zu sein, etwas an ihrem Verhältnis zu Technologie geändert habe. Ihre Antwort:
„No. In fact, the daughter of a friend of mine called me this morning and said, “I can bring an iPhone. I can explain to you how to use it.” And I said, “Not having these things is not an accident.” I know they exist. It’s like not having children: it was no accident. The only thing that makes this bearable for me, frankly, is at least I’m alone. A couple of people invited me to their houses in the country, houses much more lavish than mine. Some of them have the thing I would love to have, which is a cook, since I don’t know how to cook. And I thought, You know, Fran, you could go away and you could be in a very beautiful place with a cook, but then you’d have to be a good guest. I would much rather stay here and be a bad guest. And, believe me, I am being a bad guest.“
Sieh dir diesen Beitrag auf Instagram an
Weitere Dinge, die man im Interview über Fran Lebowitz lernt: Sie war auch vor Covid-19 schon von Keimen und Händewaschen besessen, sie ist sehr faul und hsie asst Umarmungen. Kurz gesagt: Fran Lebowitz ist exzentrisch – sehr exzentrisch. Und während ich mir sicher bin, dass sie das oft anstrengend macht, kann ich doch nicht anders, als ehrfürchtig meinen Kopf zu neigen vor dieser Frau, die so ganz sie selbst ist und sich dafür nicht entschuldigt.
Whitney – Can I be me (Arte)
Als Teenager waren meine beste Freundin und ich eine Zeit lang fasziniert von Whitney Houstons Song Your love is my love. Wir dachten uns sogar eine elaborierte Tanzroutine dazu aus, die wir kulturdem hilflosen jüngeren Bruder meiner Freundin präsentierten (hilflos, da uns und unseren Tanzschritten ohne Fluchtmöglichkeit ausgeliefert). Es war eine unschuldige Zeit, in der ich – wie der Rest der Öffentlichkeit – noch nichts von Houstons privaten Problemen, von ihrer Drogensucht und dem angeblich gewalttätigen Ehemann, wusste. Heute gilt Houston, die 2012 mit nur 48 Jahren an einer Überdosis starb, als tragische Figur: Als Sängerin verdiente sie Millionen, wurde mit Preisen überhäuft und galt als Inbegriff des Superstars. Und doch war sie unglücklich und einsam. Vor allem, das zeigen die Regisseure Nick Broomfield und Rudi Dolezal in ihrer Dokumentation Whitney – Can I be me, dass Houston nie sie selbst sein konnte. Immer spielte sie eine Rolle, immer musste nach außen hin das perfekte Bild der großen Künstlerin gewahrt werden. Indirekt zeigt der Film auch, welche Ansprüche an schwarze Künstler*innen gestellt werden und unter welchem Druck sie stehen, bestimmten Vorstellungen zu entsprechen – viel mehr als weiße Künstler*innen.
Whitney – Can I be me in der Arte Mediathek